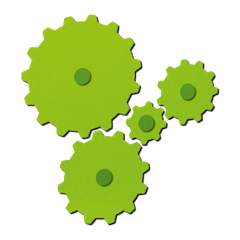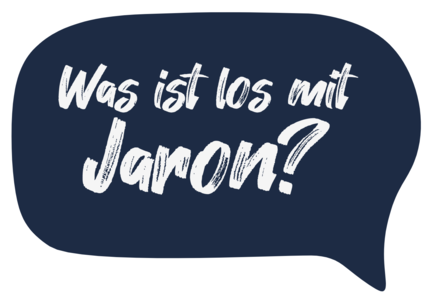Pädagogische Prävention ist vielschichtig, viele schulische Situationen und Strukturen bieten hier Anknüpfungspunkte. Drei Themenbereiche für die Zielgruppe der Schüler*innen sollten konzeptionell berücksichtigt werden:
- 1. Präventive Haltung im Schulalltag + Präventionsangebote gegen Missbrauch
- 2. Sexualpädagogik
- 3. Medienpädagogik
Zu allen drei Themenbereichen muss es entsprechende Angebote für Eltern geben:
- 4. Präventionsangebote für Eltern
1. Präventive Haltung im Schulalltag
Viele Aspekte dieser Haltung sind nicht spezifisch für sexualisierte Gewalt, sondern genauso bedeutsam etwa für die Sucht- oder die Gewaltprävention allgemein.
- Zu einer präventiven Haltung gehört, die eigene Machtposition als schulische Beschäftigte kontinuierlich zu reflektieren und gegenüber Schüler*innen einen respektvollen, grenzwahrenden Umgang, wie er auch im Verhaltenskodex formuliert ist, zu praktizieren.
- Dazu gehört weiterhin ein kritisch-bewusster Umgang mit Geschlechterrollen. Der Schulalltag bietet vielfältige Ansätze, um Frauen- und Männerbilder kritisch zu hinterfragen. Beispielsweise können Lehrkräfte überprüfen, inwieweit verwendete Unterrichtsmaterialien noch immer tradierte Geschlechtsstereotype enthalten, und – wenn sie dennoch verwendet werden sollen – mit Schüler*innen dazu ins Gespräch zu gehen. Fast alle Unterrichtsfächer bieten auch immer wieder Gelegenheiten, das Thema sexualisierte Gewalt direkt anzusprechen, sei es in Religion beim Thema „Familie“ oder in Geschichte beim Thema „antikes Griechenland“.
- Zu einer präventiven Haltung gehört weiterhin, selbstwertstärkend zu arbeiten, also Schüler*innen in ihren Stärken zu würdigen und bei ihren Schwächen zu unterstützen, wie es Schulen in der Regel auch tun. Demütigende Auswahlpraxen im Sportunterricht oder das „Wettrechnen“ in Mathe, bei denen immer die gleichen Kinder bis zum Schluss stehen bleiben, sollten der Vergangenheit angehören.
- Weitere Aspekte der präventiven Haltung sind die Fehlerfreundlichkeit und Ansprechkultur einer Einrichtung, wie sie beim Punkt „Ansprechstellen und Beschwerdestrukturen“ angesprochen werden. Je besser sie in der Schule gelebt werden, umso mehr verinnerlichen Schüler*innen diese Haltung und sind in der Lage, auch alltägliche Grenzverletzungen zu thematisieren und damit auch Übergriffe schneller zu beenden und besser zu verarbeiten. Ein wichtiger Erfolg von Prävention!
Hilfreich ist auch eine Orientierung an den sogenannten Präventionsthemen, wie sie sich in vielen Fachveröffentlichungen finden und die in speziellen Fortbildungsangeboten vermittelt werden. Weitere Informationen bietet die Website der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen
Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen
... und Präventionsangebote gegen Missbrauch
Neben dem Nutzen alltäglicher Situationen, wenn es um das Ansprechen präventiver Inhalte geht, ist es auch wichtig, regelmäßige, explizite Angebote zu machen und diese anlassbezogen durch spezielle Veranstaltungen zu ergänzen.
Unterrichtseinheiten zu sexuellem Missbrauch, zu Kinderrechten und ganz explizit zum Recht auf elternunabhängige Beratung durch das Jugendamt in Not- und Konfliktlagen, zu Übergriffen durch Kinder und Jugendliche sowie zu schulischen bzw. regionalen Hilfestrukturen sollten altersbezogen durchgeführt werden. Externe Fachkräfte aus Fachstellen zu sexualisierter Gewalt können eingeladen werden, um eine Unterrichtseinheit, Workshops oder Projekttage zu gestalten und im Anschluss gegebenenfalls eine Sprechstunde in der Schule anzubieten.
Insbesondere müssen Präventionsangebote den Eindruck vermeiden, dass Missbrauch die Zukunft eines betroffenen Kindes zerstört. Vielmehr sollte erklärt werden, dass Missbrauch Menschen stark belasten, aber durch Trost, Unterstützung und gegebenenfalls Therapie verarbeitet werden kann.
Wer selbstständig Aufklärung über sexuellen Missbrauch in der Klasse durchführen will, sollte die folgenden Aspekte vermitteln:
- dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen sexuelle Gewalt widerfahren kann
- dass Männer, aber auch Jugendliche und manchmal auch Frauen Täter bzw. Täterinnen sein können
- dass die meisten Menschen Mädchen und Jungen keine sexuelle Gewalt antun
- dass man den meisten Tätern und Täterinnen ihre Absichten nicht ansieht und sie oft sogar sympathisch sind
- dass es häufig bekannte und vertraute Menschen und nur selten Fremde sind
- dass sexueller Missbrauch nichts mit Liebe zu tun hat
- dass Missbrauch oft strategisch angebahnt wird
- dass sexueller Missbrauch aufseiten der Kinder und Jugendlichen oft mit komischen und verwirrenden Gefühlen beginnt
- dass bei betroffenen Kindern und Jugendlichen keine Schuld liegt
- dass Mädchen und Jungen auch in Chatrooms und in sozialen Netzwerken sexuelle Gewalt widerfahren kann
- dass es auch sexuelle Übergriffe unter Kindern oder unter Jugendlichen gibt und dass man auch in diesen Fällen ein Recht auf Hilfe hat
Es ist sehr zu empfehlen, bei der selbstständigen Aufklärungsarbeit über sexuellen Missbrauch Materialien aus Fachstellen zu verwenden, wie z. B. den Trickfilm „Sexueller Missbrauch – Infos für Kids“ (siehe Tipps/MATERIAL PRÄVENTION), der zentrale Botschaften für die Präventionsarbeit mit Kindern ab dem Grundschulalter enthält. Für die präventive Arbeit mit Grundschüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen eignen sich beispielsweise die Materialien des Projekts „Ben und Stella“ (siehe Tipps/MATERIAL PRÄVENTION). Jugendliche Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen können beispielsweise durch den Comic (mit Manual) „Alles Liebe“ (siehe Tipps/MATERIAL PRÄVENTION) das Thema sexueller Missbrauch kennenlernen. Die meisten Materialien für Jugendliche fokussieren das Spannungsfeld „Sexualität zwischen einverständlichen und grenzüberschreitenden Situationen unter Gleichaltrigen“ (auch dazu siehe Tipps/MATERIAL PRÄVENTION). Für jugendliche Schüler*innen sollten schulische Präventionsangebote deshalb auch explizit sexuellen Missbrauch durch Erwachsene thematisieren.
Weil betroffene Jugendliche, aber auch Kinder oft als Erstes ihre Freund*innen ins Vertrauen ziehen, muss in der Präventionsarbeit immer auch an diese Zielgruppe gedacht werden. Viele Jugendliche und Kinder fühlen sich unsicher, wie sie mit dieser Information umgehen sollen, was sie sagen, wie sie reagieren sollen. Auf solche Situationen, ihre Möglichkeiten und Chancen, aber auch ihre möglichen Belastungen sollten Jugendliche und Kinder vorbereitet werden. Für die Arbeit mit jugendlichen Schüler*innen kann beispielsweise auf das Angebot washilft.org (siehe Tipps/MATERIAL PRÄVENTION) zurückgegriffen werden.
Eine kleine Auswahl an bundesweiten Theaterstücken, Ausstellungen und anderen Projekten findet sich unter Tipps/PROJEKTE.
2. Sexualpädagogik
Pädagogische Prävention ist mehr als Sexualpädagogik, aber ohne Sexualpädagogik wäre Prävention unzureichend. Wissen und Sprechen über sexuelle Themen stellen einen wichtigen Schutz dar: Wer über Sexualität gut informiert ist, kann leichter über sexuelle Gewalt sprechen und sie von Sexualität unterscheiden.
Deshalb kann die Schule im Rahmen des Bestandteils „Präventionsangebote“ die Bedeutung der Sexualerziehung im Rahmen des Lehrplans betonen und eigene Schwerpunkte setzen. Darüber hinaus sollte sich das Kollegium verpflichten, anlassbezogen und fächerübergreifend im Schulalltag auf sexuelle Themen und sexuelle Aktivitäten einzugehen, aber auch auf sexuelle Übergriffe durch Schüler und Schülerinnen fachlich angemessen zu reagieren. Die Richtlinien und Lehrpläne der Bundesländer zur schulischen Sexualerziehung bieten hier konkrete Hinweise zur Ausgestaltung und Umsetzung. Zur Unterstützung gibt es zum Teil spezifische Handreichungen und Unterrichtsmaterialien zur Sexualerziehung. Fachleute von pro familia oder von Familienplanungszentren können hier beraten und punktuell unterstützen. Damit diese konzeptionelle „Selbstverpflichtung“ auch tatsächlich gelingt, sind thematische Fortbildungen und Studientage zu empfehlen, denn Sexualerziehung führt in vielen Lehramtsausbildungen, wie Studien zeigen, nach wie vor ein Schattendasein.
Präventionsangebote unmittelbar in sexualpädagogische Arbeit zu integrieren, ist jedoch nicht ratsam. Im Rahmen von sexualpädagogischem Unterricht über Missbrauch und andere Formen sexueller Gewalt aufzuklären, kann bei Schüler*innen zu dem Eindruck führen, sexueller Missbrauch sei eine (negative) Form von Sexualität. Kinder profitieren allerdings am meisten von Angeboten zum Schutz vor sexueller Gewalt, wenn sie vorher eine ganzheitlich und positiv orientierte Sexualerziehung erfahren haben, die ihnen fachlich fundierte Informationen, Lebenskompetenzen und Werte im Umgang mit Körper, Sexualität und Beziehungen vermittelt. Mit der Trennung sexualpädagogischer Angebote von Aufklärung über sexuelle Gewalt signalisiert die Schule, dass sexueller Missbrauch eine Form von Gewalt ist.
3. Medienpädagogik
Die meisten Kinder und Jugendlichen im Schulalter besitzen eigene Smartphones oder Tablets oder haben zumindest Zugang dazu. Über soziale Plattformen, Games oder Messenger können Täter und Täterinnen in einem ungeschützten Raum sexuelle Kontakte anbahnen, sogenanntes Cybergrooming. Sexualisierte Gewalt kann aber auch unter Minderjährigen stattfinden, z. B. durch das unerlaubte Weiterleiten von selbst erstellten erotischen Aufnahmen (Sexting) oder durch die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen durch Kinder und Jugendliche selbst, die sich über die Bedeutung ihres Tuns oft gar nicht im Klaren sind. Auch von sexuellen Übergriffen aufgrund von Social-Media-Trends, die zu grenzverletzendem Verhalten ermutigen und die auf Schulhöfen kursieren, sind Schüler*innen betroffen.
Präventionsangebote sollten daher immer auch den digitalen Raum einbeziehen und darauf abzielen, Schüler*innen zur kritischen Auseinandersetzung mit digitalen Medien zu befähigen, anstatt sie davor nur zur warnen und zu bewahren.
Medienpädagogik ist für Schulen selbstverständlich kein Neuland. Spätestens seit die Kultusministerkonferenz 2016 die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ verabschiedet hat und die Länder diese mit eigenen Beschlüssen untersetzt haben, hat sie zunehmende Bedeutung in den einzelnen Schulen erlangt. Ziel ist es, dass alle Schüler*innen bis zum Ende der Pflichtschulzeit bestimmte Medienkompetenzen wie das Erkennen von Risiken in der digitalen Welt, das sichere Kommunizieren, kritische Analysieren und Reflektieren von digitalen Diensten erwerben.
Weil das Thema digitale sexualisierte Gewalt jedoch oft noch nicht explizit und ausreichend berücksichtigt wird, sollte die medienpädagogische Prävention von sexueller Gewalt im Rahmen des Schutzkonzepts verbindlich formuliert werden. Dazu gehört, welche digitalen Geräte und Medien wann im Schulalltag genutzt werden (sowohl von Schüler*innen als auch von Lehrkräften), welche Regeln für den Klassenchat oder den Umgang mit Fotos gelten und eine Vereinbarung, dass Lehrkräfte fächerübergreifend, altersangemessen und wiederholt an geeigneten Stellen im Unterricht Risiken von (sexualisierter) Gewalt im Umgang im digitalen Raum thematisieren. Und nicht zuletzt gehört zu medienpädagogischer Prävention, Schüler*innen zu vermitteln, wo es in schwierigen Situationen Unterstützung und schnelle Hilfe gibt. Übrigens: Laut einer Studie der Landesmedienanstalt NRW von 2022 zu Cybergrooming wünschen sich 65 % der befragten Schüler*innen, dass Schule dieses Thema stärker behandelt!
Im Unterricht kann konzeptionell an vielen Themen angesetzt werden: Beispielsweise kann im Unterrichtsfach Geschichte das Thema über die Entstehung der Kinderrechtskonvention eingeleitet werden, in Englisch über die kritische Analyse von Songtexten, in Deutsch über die Veränderung von Sprache (Jugendsprache, Chatsprache), in Ethik über das Thema Geschlechterstereotype. Auf der Website „Wissen hilft schützen“ (Tipps/MEDIENPÄDAGOGIK) finden sich hilfreiche Materialien für den Unterricht, vom sicheren Erstellen von Profilen über Selbstdarstellungen bis zu Sexting-Regeln.
Präventive Medienpädagogik sollte kein Spezialthema für die IT-Expert*innen der Schule sein, sondern als Aufgabe von allen Beschäftigten wahrgenommen werden. Das kann nur gelingen, wenn thematische Fortbildungen (siehe Bestandteile/FORTBILDUNGEN) besucht werden, damit die eigene Kompetenz weiterentwickelt wird. Lehrkräfte brauchen nicht in der Tiefe das Wissen zu erwerben, das heutige Kinder und Jugendliche als „Digital Natives“ oft mitbringen. Sie sollten sich aber gegenwartsorientiert mit der Lebenswelt ihrer Schüler*innen beschäftigen und die aktuell bei Kindern und Jugendlichen angesagten Messenger, digitalen Plattformen und Spiele kennen. Lehrkräfte benötigen ein Grundlagenwissen zum rechtlichen und vor allem pädagogischen Umgang mit digitaler sexueller Gewalt. Dazu gehört das Wissen über die entwicklungsbedingten Grenzen des Selbstschutzes von Kindern und Jugendlichen. Gerade von Jugendlichen, die natürlicherweise nach Autonomie streben, wird oft erwartet, dass sie Risiken ihrer digitalen Aktivitäten abschätzen können. Zu wissen, dass das hirnorganisch in diesem Alter noch gar nicht vollständig möglich ist, ermöglicht es Lehrkräften, ihren Schüler*innen zu vermitteln, dass sie keine Schuld trifft, wenn sie digitale sexuelle Gewalt erleiden. Für die konkrete Unterstützung nach Vorfällen digitaler sexueller Gewalt brauchen Schulen Kontakte zu spezialisierten Fachberatungsstellen, die die Betroffenen, ihre Eltern und die Schule beraten können (siehe Bestandteile/KOOPERATION). Einige digitale Anlaufstellen finden sich unter Tipps/MEDIENPÄDAGOGIK.
4. Präventionsangebote für Eltern
Auch für Eltern sollte es sowohl regelmäßige als auch anlassbezogene Veranstaltungen geben, die sie in die schulische Präventionsarbeit einbeziehen. Von Fachberatungsstellen herausgegebene Informationsbroschüren für Eltern, wie sie unter Tipps/ELTERNARBEIT zu finden sind, können hier eine gute Unterstützung bieten. Dieses Material kann auch die Eltern erreichen, die an den entsprechenden Veranstaltungen nicht teilnehmen können oder wollen. Bereits in der Grundschule ist es wichtig, dass es Elternabende zu den Themen „Wie schütze ich mein Kind vor sexueller Gewalt?“ sowie „Wie begleite ich eine gesunde Sexualentwicklung?“ und auch zum Thema Medienkompetenz im Umgang mit digitalen Medien gibt. Durch solche Angebote bekommen Eltern die Chance, in ihrem Familienalltag präventive Aspekte selbst zu berücksichtigen und diese Themen gemeinsam mit der Schule anzugehen.
Eltern befürchten manchmal, ihre Kinder könnten durch Präventionsangebote mit zu stark belastenden Fakten konfrontiert werden. Diese Sorge ist nicht unberechtigt, gibt es doch tatsächlich Angebote, die Ängste schüren. Deshalb ist es wichtig, schulische Prävention an Qualitätskriterien auszurichten, die sicherstellen, dass Prävention auf eine Weise Wissen vermittelt, die Mädchen und Jungen stärkt, Spaß macht und nicht ängstigt (Links zu Qualitätskriterien für Präventionsangebote finden sich unter Tipps/MATERIAL PRÄVENTION).
Gerade bei der Sexualerziehung bieten Elternabende die Chance, das Vertrauen der Eltern in die schulische Sexualerziehung und ihre Anliegen zu gewinnen, Unsicherheiten abzubauen und Eltern zu ermutigen, dieses Bildungsthema nicht an die Schule abzutreten, sondern es aktiv mitzugestalten. In der Regel sind Eltern sehr dankbar für die Unterstützung der Schule in diesen Fragen. Manche Eltern stehen solchen Angeboten auch kritisch gegenüber, unter Umständen, weil sie aus ihrem religiösen oder kulturellen Verständnis heraus das Sprechen über Sexualität ablehnen. Schulen sind dann manchmal geneigt, sich am (vermuteten) kleinsten gemeinsamen Nenner der Elternschaft zu orientieren, statt wie in anderen Themenfeldern eigene pädagogische Standards zu formulieren und die Eltern – auch mithilfe von sexualpädagogischen und Präventionsfachkräften – davon zu überzeugen. Wo dies nicht gelingt, kann letztlich nur der Hinweis auf den schulischen Bildungsauftrag, der im Rahmen der landesgesetzlichen Curricula auch Sexualerziehung enthält, helfen.
Sowohl für die Präventionsarbeit wie auch für die Sexualerziehung ist es wichtig, Eltern frühzeitig einzubeziehen und zu informieren, ihren Bedenken und Fragen Raum zu geben, bevor die entsprechende Unterrichtseinheit stattfindet.